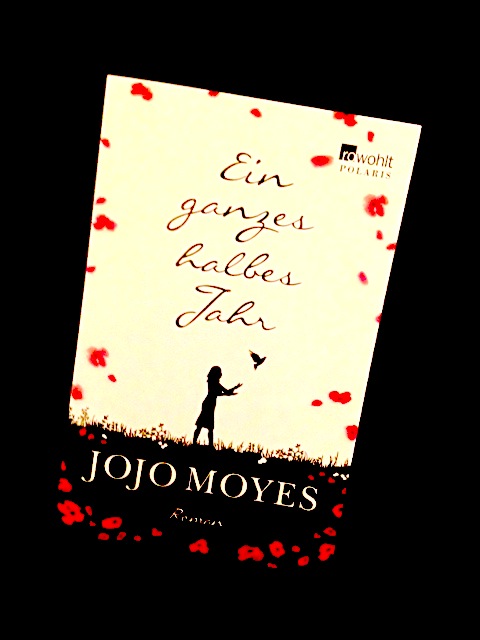Gerade sprießen überall Artikel aus dem Boden, in denen es darum geht, dass unsere Gesellschaft immer unverbindlicher wird. Die medienaffinen Youngsters haben sich schon lange in iPhone und Co. verliebt und nutzen vor allem Hilfsmittel wie WhatsApp, um… ja, um was vor allem? Meine Meinung, ganz ehrlich: um abzusagen. Immer und immer wieder.
Ich liebe WhatsApp und schließe mich nicht aus. Aber ich merke in letzter Zeit extrem, dass es einem damit so leicht gemacht wird, den inneren Schweinehund nicht zu überwinden. Da hat man für Sonntagnachmittag ausgemacht, mit der Freundin einen Kaffee trinken zu gehen. Man blickt eine Stunde vor dem Treffen hinaus und sieht dicke Gewitterwolken. Kurze Zeit später ein unverkennbares „Piep“ – und die Absage steht schwarz auf farbigem Fotohintergrund. Yo. So oder so ähnlich passiert mir das immer öfter. Und ich bin nicht die einzige Leidensgenossin.
Mein Freund hatte mal für eine längere Zeit kein Handy, weil er es verloren und beschlossen hatte, sich kein Neues zu kaufen. Vorerst zumindest. Das Resultat? Ein auf einmal wieder klingelndes Festnetz (auch ich vergesse ständig, dass ich so ein Gerät besitze), durch das Freunde sich vergewissern wollten, ob er noch zu Hause sei, damit sie das ausgemachte Treffen absagen oder verschieben konnten. Nur leider hatte er sich da schon meist auf den Weg gemacht, sprich, man wurde gezwungen, die Verabredung einzuhalten. Er schwärmt heute noch von der Zeit, ein regelrechter Luxus, dass sich die Welt auf einmal so schwindelnd um ihn drehte. Seine Freunde fluchen bis heute darüber.
Warum eigentlich? Nur, weil die Faulheit einen Klick entfernt ist, neigen wir auf einmal dazu, unsere Freunde ständig zu versetzen oder gar ganz zu vernachlässigen? Heißt das, dass wir früher auf mindestens die Hälfte aller Treffen gar keinen Bock hatten, es aber nicht weiter aufgefallen ist, weil man nicht kurzfristig nein sagen konnte? Finde ich irgendwie deprimierend. Wenn ich überlege, in welchen WhatsApp-Gruppen ich schon steckte und wie da manchmal über zwanzig Nachrichten hinweg ausgemacht wurde, wo man sich wann am besten treffen könne, lasse ich mich nun einfach vom Stuhl gleiten und schlafe eine Runde auf dem Boden.
Das Problem ist, dass wir alle voneinander wissen, wie oft wir auf unser Display starren. Man kann kaum jemanden vormachen, man hätte den ganzen Tag sein Handy nicht in der Hand gehabt und daher eine Nachricht übersehen. Und aus diesem Grund verlässt sich jeder darauf, kurz noch ein Beautyprogramm am Abend einzuschieben oder jemanden auf den nächsten Tag zu vertrösten, denn man hat ja abgesagt.

Bildquelle Mike Licht (cc by sa 2.0, flickr)
Am liebsten würde ich es wirklich mal durchziehen, zu jedem verabredeten Zeitpunkt an dem besagten Treffpunkt zu erscheinen. Denn Menschen immer und immer wieder zu versetzen, ist eine Sache, die mich tierisch wütend macht, aber jemanden vor Ort alleine stehen zu lassen, eine ganz andere. Könnte spannend werden.
Es ist nicht so, dass ich mich für ein Unschuldslamm halte. Auch ich bin big in love mit meiner digitalen Welt. Und ich habe sicherlich auch schon aus Faulheit oder schlechter Planung jemanden versetzt. Dennoch achte ich im Allgemeinen darauf, ob ich zu- oder absage. Denn, darf ich vorstellen: der Terminkalender. Steht nichts drin, kann ich zusagen. Steht was drin, kann ich absagen. Aber dieses „ich muss mal schauen“ ist pure Ausrede. Mal schauen, ob ich an dem Tag in der Stimmung bin oder nicht doch der schöne Prinz mit seinem Gaul vorbeireitet, das wäre natürlich die viel bessere Option für einen Sonntagnachmittag.
Ich kann nicht mit Halbsachen. Ich will Hü oder Hott, aber nicht Hüott. Irgendwas dazwischen befriedigt mich nicht, außerdem bin ich zu ungeduldig, um darauf zu warten, ob mein Gegenüber fertig geschaut und gewartet hat. Ne, dafür ist das Leben zu kurz. Ich bin Fan von impulsiven Entscheidungen, das sind die Richtigen, weil eben spontan und frei heraus. Kein Komma, sondern Punkt. Keine Romane via SMS, sondern konkrete Aussagen. Kein „steht das mit heute Abend eigentlich noch“, wenn es erst vor ein paar Stunden ausgemacht wurde. Kein „mal schauen“, wenn man eigentlich nicht will. Wir sind alle erwachsen und verkraften nach etlichen Nicht-Anrufen von vermeintlichen Traummännern auch mal eine konkrete Absage der Freundin.
Und weil ich finde, dass Klarheit, Schnelligkeit und Struktur etwas ist, was man lernen kann, habe ich nach einem spontanen Bedürfnis, mir die Haare schneiden zu lassen, diesem Gedanken nachgegeben. Am Vormittag angedacht, abends Schnitte gegoogelt, am nächsten Tag zum Friseur gestapft.
„Wie möchten Sie es geschnitten haben?“ Dreimal dürft ihr raten, was ich gesagt habe, aber „schauen wir mal“ habe ich ganz sicher nicht geantwortet.
Punkt.